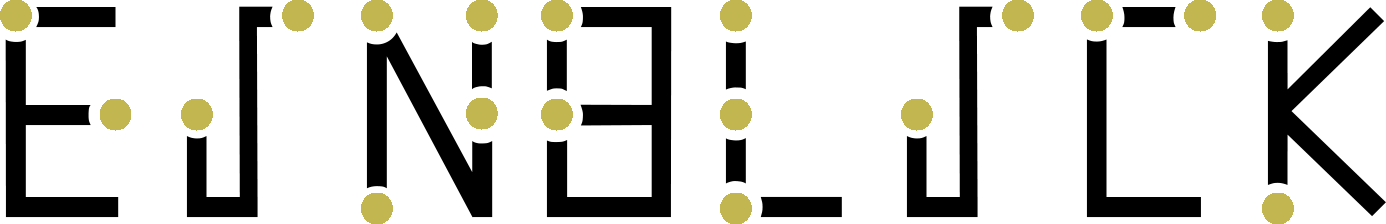 eine Reportage
eine Reportage
Hallo liebe Besucher, die ihr euch den Inhalt dieser Seite mit dem Screenreader durchlest. Diese ersten Zeilen sind nur für euch bestimmt, denn Nicht-Blinde sehen hier stattdessen das Titelbild. Es zeigt mich, die Verfasserin der Reportage, mit den Protagonistinnen Angelika und Daniela beim Kartenspielen. Ich habe zuvor noch nie eine eigene Webseite hergestellt, und noch weniger, eine möglichst blindengerecht aufbereitete. Bitte gebt mir Bescheid, wenn ich etwas ändern und verbessern kann. Ihr helft mir und anderen Lesern damit. Danke!
Ich wünsche euch eine schöne Lektüre.
Barbara
Einleitung
Sorgfältig tasten die Fingerkuppen über die linken Ecken der Karten. Dort verharren sie kurz und lesen das eingravierte Punktbild ab. Die soeben gezogene füllt die Lücke der Zahlenreihe. "Ich geh runter!", ertönt es da schon. Meine blinden Freundinnen Angelika und Daniela besiegen mich wieder einmal beim Kartenspielen. Die Runde ist schneller als mir lieb ist, vorbei. "Wie viele Punkte hast du?". Zu viele. Angelika zählt zusammen und gibt den aktuellen Punktestand bekannt. Sie liegt vorne. "Weißt du, einmal hat mich jemand gefragt: 'Was, du kannst rechnen?'", erzählt sie mir jetzt. Aber da gibt es noch mehr Fragen, über die sie sich wundern könnte.
Denn "blöde" Fragen sind den Zwillingen lieber als keine Fragen. Als Leute, die sie anstarren oder über sie tuscheln. Als würden sie das nicht mitkriegen, meinen sie, "hören können wir nämlich". Und so habe ich ihnen Fragen gestellt. Viele. Auch "blöde" Fragen oder Fragen, die sie immer wieder zu hören bekommen. Wie eben die nach den Träumen. Und ihre Antwort kann ich gleich vorwegnehmen: In ihren Träumen sieht die Welt nicht anders aus, als sie sie aus dem wachen Zustand kennen.
... in ihre Art, das Leben zu sehen
Daniela und Angelika haben Lebersche kongenitale Amaurose, genannt auch LCA oder Lebersche angeborene Blindheit. Sie ist eine von vielen Augenerkrankungen, die zur Reduktion oder zum Verlust des Sehvermögens führen können. Das betonen auch die beiden immer wieder: Es gibt unterschiedliche Arten von Blindsein. Verschiedene Erkrankungen, verschiedene Stadien und Ausprägungen der Erkrankung, verschiedene Partien des Auges, die betroffen sein können. Manche Menschen erblinden im Laufe ihres Lebens, andere sind von Geburt an blind. Viele Blinde sehen Lichtblitze. Andere sehen verschwommen. Wieder andere nur einen Teil vom Gesichtsfeld. Einige sind komplett ohne Lichtwahrnehmung, also vollblind.
Die Lebersche kongenitale Amaurose ist eine vererbte Netzhauterkrankung. Auch ihr Bruder hat sie, ihre Schwester wiederum nicht. Betroffene sind bereits bei der Geburt blind oder hochgradig sehbehindert. Wenn Sehreste vorhanden sind, dann schwinden sie meistens mit den Jahren. Ob sie das mitbekommen, frage ich sie. Angelika, die glaubt, etwas besser zu sehen als ihre Zwillingsschwester, schon. Sie könne es sowieso nicht ändern, meint sie, darum störe es sie auch nicht. Es wird bereits an Therapiemöglichkeiten geforscht und immer wieder wird ein vermeintlicher Durchbruch verkündet, erzählen mir die Zwillinge. Dadurch will man das Sehvermögen teilweise rückgewinnen. Ihnen machen diese Ansätze allerdings keine großen Hoffnungen. Und sowieso sei es bei ihnen bereits zu spät." Stell dir vor, sie würden das mit uns machen. Wir hätten die ure Reizüberflutung. Was wir nicht für das Sehzentrum verwenden, setzen wir für andere Sinne ein. Es wäre viel zu viel, verstehst du, wir würden mit der Welt nicht mehr klarkommen".
Die fehlende Sehkraft wird etwa durch den Hörsinn kompensiert. Dass dieser besser ist als bei Sehenden, würden sie so nicht sagen.
Ob ihnen etwas fehlt, möchte ich wissen. "Weißt du, normalerweise vermisst man ja keine Sachen, die man nicht kennt..." sagt Daniela, und durch die Blume, dass dies wohl wieder eine dieser Fragen war. "Natürlich ist es manchmal blöd. Oft würde ich schon gerne wissen, wie die Person aussieht, mit der ich gerade spreche". Aber sie konzentrieren sich auf die guten Seiten. Blind zu sein hätte ja auch Vorteile, meinen sie. So lernen sie Menschen kennen, mit denen sie sonst nicht in Berührung gekommen wären. Überhaupt lernen sie Menschen auch besser und intensiver kennen, lernen, sie einzuschätzen. Ob diese ihnen, wenn nötig, helfen würden, ob sie ihnen vertrauen können. Ob sie es gut mit ihnen meinen. Worauf sie beim ersten Kontakt achten, hake ich nach, wenn das Aussehen keine Rolle spielt? Besonders auf die Stimme. Wie eine Person spricht, wie sie sich ausdrückt und wie sie mit ihren Mitmenschen umgeht. "Außerdem kriegt man ja mit, ob die jetzt lächelt oder nicht."
... in ihren Weg, durch das Leben zu gehen
Akustische Eindrücke sind auch für die räumliche Orientierung wichtig. Aber auch Gerüche, erklären mir Angelika und Daniela. "Sind wir in einer bekannten Gegend unterwegs, wo es immer, sagen wir, nach Leder riecht, dann wissen wir, dass hier das Schuhgeschäft ist". Mit dem Blindenstock ertasten sie Hindernisse wie Stufen oder Randsteine. Oder taktile Leitlinien, die sie zum Beispiel durch U-Bahn-Stationen führen. Für einen barrierefreien öffentlichen Raum sollte das "Zwei-Sinne-Prinzip", im Idealfall "Mehr-Sinne-Prinzip" angewendet werden. Es besagt, dass für eine Informationsvermittlung – für alle – mindestens zwei Sinne angesprochen werden müssen. Eine Ampel zum Beispiel: Sie gibt über ihre drei unterschiedlichen Farben visuelle Signale. Sie spricht den Sehsinn an. Daneben gibt ein in der Regel gelbes oder oranges, in Wien meist blau-gelbes, Kästchen ein Ticken oder Piepen wieder. Wird der Ton schneller, wissen Blinde, die Ampel ist grün. Dies kann auch über taktile Signale geschehen. Neben dem normalen Knopf, mit dem Fußgänger das Grün-Signal anfordern, gibt es an manchen Armaturen einen weiteren an der Unterseite. Wie oft irrtümlich angenommen, sorgt er nicht dafür, dass die Ampel schneller auf Grün schaltet, sondern vibriert, wenn sie es tut. Zudem zeigt ein Pfeil die Richtung an, in der die Straße zu queren ist.
In Wien werde das Mehr-Sinne-Prinzip allerdings vielerorts vernachlässigt, kritisiert Mathias Schmuckerschlag. Er ist Leiter des Bereiches Mobilität und Infrastruktur beim Verein Blickkontakt, der sich für blinde und sehbehinderte Menschen einsetzt. So werden Fahrgastinformationen immer häufiger nur mehr optisch angezeigt, auf Anzeigetafeln oder Infoscreens etwa, während An- und Durchsagen oft zu leise sind oder ganz ausbleiben. Zudem sei das Leitliniensystem in vielen U-Bahn-Stationen in einem schlechten Zustand. Abgenutzt und nicht mehr fühlbar, und oft werde vergessen, dass es für sehbehinderte Menschen in einem farblichen Kontrast zur Bahnsteigfarbe erkennbar sein muss. Generell herrsche großer Aufholbedarf, was ein barrierefreies Wien anbelangt. Mehr noch, die Situation verschlechtere sich, sagt der selbst von Geburt an Blinde:
Er appelliert an die zuständigen Stellen, nicht auf Blinde und ihre Anliegen zu vergessen. Bei der Errichtung einer Begegnungszone etwa, deren Konzept auf gegenseitige Rücksichtsnahme und somit hauptsächlich auf Blickkontakt basiert, darf nicht auf ein gut ausgebautes taktiles Leitsystem verzichtet werden. Ebenso wenig auf die Durchsage von Fahrgastinformationen. Dies betrifft die Ansage von hereinkommenden Zügen oder Linien, wie auch jene der Stationen im Inneren des Verkehrsmittels.
"Also wir finden uns gut zurecht", entgegnen Angelika und Daniela. Aber fügen hinzu: "Wir sind ja auch immer zu zweit unterwegs". Wenn möglich, wählen sie Routen, die sie bereits kennen und wo das Umsteigen keine Probleme bereitet. Die Längenfeldgasse ist zum Beispiel ein guter Umstiegsort. Dort liegen zwischen der U4 und der U6 nur ein paar Schritte. Bei fehlenden Durchsagen müssten sie eben andere Passanten fragen. Man müsse schon viel mit Fremden kommunizieren, sind sie sich einig. In bestimmten Situationen, in denen man Hilfe benötigt. Beim Umsteigen etwa, oder wenn man die Gegend nicht so gut kennt. Das sei auch nicht jedermanns Sache. Doch die meisten Leute seien hilfsbereit und geben gerne Auskunft. Manche meinen es allerdings fast zu gut, erzählen sie: "Manchmal packt uns jemand einfach am Arm und zieht uns in irgendeine Richtung. Dabei weiß er noch nicht einmal, wohin wir wollen oder ob wir überhaupt Hilfe benötigen."
Auf eine andere Weise orientiert sich Erich Schmid, Lehrer am Blindeninstitut in Wien und auch von Geburt an blind. Er beherrscht die sogenannte Klicksonar-Technik, bekannt auch unter Echolokalisation oder aktiver Echoortung. Er "sieht" seine Umgebung mit den Ohren, oder besser gesagt, mit dem Gehirn. Denn dort wird das Echo, das er zuvor mit einem Zungenklick produziert, zu einem Bild geformt und interpretiert.
Er erkennt, um welche Art von Hindernis es sich handelt, wie hoch die Mauer oder der Zaun vor ihm ist, wie weit der Fußgänger von ihm entfernt ist. Im Normalfall wird diese Technik aber mit dem Blindenstock kombiniert. Denn Gefahren lauern oft auf dem Boden. "Ich bin kein gutes Vorbild", lacht Schmid, "aber ich verlasse mich zu stark auf die Echoortung. Die Aussendung des akustischen Signals erfolgt ja durch den Mund und die Ohren sind auf derselben Höhe wie der Mund, dadurch ist die Auswertung der Bilder viel präziser." Auch im Tierreich wird die Echoortung eingesetzt, erzählt er. Von Fledermäusen oder Delphinen und Walen, zum Beispiel. Sie wenden sie auf der Jagd an oder generell, um sich zu orientieren.
... in Alltag und Freizeit
Einen Großteil ihrer Zeit verbringen Angelika und Daniela in der Schule. Sie besuchen den Aufbaulehrgang der Vienna Business School im 8. Wiener Bezirk. Während ihre Mitschüler im Unterricht ihr Heft befüllen, arbeiten sie auf dem Computer. Viele ihrer Lehrer schreiben Schlagwörter für die Klasse nicht nur an die Tafel oder beamen sie an die Wand, sondern speichern ein Extra-Dokument auf ein gemeinsames Laufwerk, ab. Von dort holen es sich die Zwillinge und können damit arbeiten. Ein Screenreader gibt ihnen den Inhalt entweder über eine Sprachausgabe aus oder über die Braillezeile in Blindenschrift. In der Blindenschrift kann jedes Zeichen anhand von sechs möglichen Punkten, drei in der Höhe und zwei in der Breite, dargestellt werden. Diese Punkte werden von der Rückseite aus in dickes Papier gestanzt und sind somit erhaben und fühlbar. Jeder Buchstabe und jedes Zeichen hat eine eigene Anzahl und Anordnung der Punkte. Blinde ertasten mit den Fingerkuppen die Punkte und lesen so mit ihren Fingern. Die Braillezeile schließen sie an Computer oder Laptop an. Hier sind es acht kleine Stifte für jeden Buchstaben, die sich auf und ab bewegen und ein Punktbild formen.

Nicht jeder Content im Internet kann problemlos vom Screenreader erfasst werden, denken wir nur an Fotos, Grafiken oder Tabellen. Damit blinde Schülerinnen und Schüler Unterrichtsmaterialien lesen können, müssen diese erst dementsprechend aufbereitet werden. Das geschieht etwa im Braille-Zentrum des Bundes-Blindeninstituts Wien. Dort arbeitet Ursula Sztuparits, gelernte Buchbinderin. Früher hat sie Bücher in Brailleschrift für die Bücherei gebunden. Doch in den letzten Jahren hat sich alles sehr verändert, erzählt sie. Gebundene Bücher in Braille werden nicht mehr so oft hergestellt. Alte Bestände werden sehr wohl in gutem Zustand gehalten und regelmäßig überprüft, ob die Punkte noch nicht zu abgenutzt sind oder repariert werden müssen. Aber die meisten Schüler am Institut lesen heute digital am Computer. So liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der blindengerechten Aufbereitung von Zeitschriften und Magazinen. Für deren digitale wie auch haptische Nutzung. Sie bearbeitet Texte aus dem JÖ, dem TOPIC, aus LUX, das ist das ehemalige Kleine Volk, aus der Spatzenpost und dem YEP. Worauf sie dabei achten muss?
Die Zeitschriften in Braille sind nicht nur für Schülerinnen und Schüler des Blindeninstituts. Sztuparits verschickt sie per E-Mail auch an andere Blinde und Sehbehinderte in ganz Österreich, auch an ganze Integrationsklassen oder -schulen. Neben eben jener im zweiten Wiener Bezirk gibt es das Odilieninstitut in Graz oder die Landesblinden- und Sehbehindertenschule in Innsbruck.
Angelika und Daniela, die früher auch das Wiener Blindeninstitut besucht haben, lesen nicht sehr viel, geben sie zu. "Wir tratschen viel lieber." Und ins Theater gehen sie auch gern. Einige Spielstätten bieten zu bestimmten Aufführungen eine Live-Audiodeskription an. Über eine Radiofrequenz werden blinden Besuchern Informationen über das Bühnengeschehen gegeben. Über Bühnenbild, Kostüme oder Bewegungen der Schauspieler etwa. Genauso wie es bei vielen Filmen oder Serien möglich ist. Die Zwillinge sind keine großen Freundinnen von Audiodeskription. "Wir fragen lieber die Mama, wenn uns eine Information fehlt. Die weiß immer genau, was wir wissen wollen". Auch im Museum gibt es besondere Vorstellungen für visuell beeinträchtigte Besucher. Dort dürfen zum Beispiel Exponate berührt und so greifbarer gemacht werden.
Eine Leidenschaft haben die beiden für Musik. Stundenlang hören sie sich über Youtube Musik an. Wie sie eigentlich auf dem Handy navigieren, frage ich sie. Mit VoiceOver, erklären sie mir. Eine Sprachausgabe, die im iPhone integriert ist und ihnen die Inhalte vorliest.
"Sehr musikalisch" trifft es. Denn darin sind sich die zwei einig: "Ohne Musik wären wir wahrscheinlich schon draufgegangen". Sie nehmen nicht nur Gesangsunterricht und singen im Chor. Sie spielen auch Instrumente. "Wir waren noch ganz klein, als unser Bruder schon lang Klavier gespielt hat. In Konzerten oder bei Auftritten vom Percussion Ensemble sind wir immer eingeschlafen, das hat uns beruhigt. Dann haben wir einmal gesagt, wir wollen Klavier lernen, und ab da sind immer mehr Instrumente dazugekommen." Heute sind es neben Klavier Posaune, Klarinette, Geige und Gitarre. Wenn sie zu zweit in die Tasten greifen, klingt das so:
Noch etwas hat in ihrer Freizeit Platz: der Sport. Angelika und Daniela spielen Goalball und Torball, typische Blindensportarten. Ich habe sie zu einem Goalball-Training begleitet und mir die paralympische Mannschaftssportart angeschaut.

Ursprünglich wurde sie im Jahr 1946 für kriegsversehrte erblindete Soldaten erfunden. Heute ist sie die weltweit verbreitetste Ballsportart für Menschen mit einer Sehbehinderung. Zwei Teams zu je drei Spielern stehen sich auf einer Fläche von 18 mal 9 Metern gegenüber. Ziel ist es, den ca. 1,25 Kilo schweren Ball in das gegnerische Tor zu bekommen. Der Ball hat im Inneren eine Klingel befestigt. So kann abgeschätzt werden, aus welcher Richtung er kommt. Dann wird versucht, ihn rechtzeitig abzufangen und das Tor zu verteidigen. Dafür muss voller Körpereinsatz gezeigt werden, denn das Tor erstreckt sich über die gesamte Spielfeldbreite von neun Metern. Alle Spieler tragen eine Augenbinde, damit jeder Spieler gleich wenig sieht und die gleichen Chancen hat. Chancengleichheit. Ein Ziel, das nicht überall erreicht wird.
... in Situationen, in denen sie auf Grenzen stoßen
"Ich kann mit der Frage nicht so viel anfangen", reagiert Daniela verwirrt, "so wirkliche Grenzen... ich mein, in der Berufswahl wird es für uns Grenzen geben. Uns ist glaube ich allen klar, dass Angelika und ich jetzt nicht Pilotinnen oder Busfahrerinnen werden." – "Und fotografieren oder so können wir auch nicht zum Hobby machen", fällt ihr diese ins Wort. "Aber wenn wir zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und nicht weiterwissen, dann fragen wir halt andere Leute."
Mathias Schmuckerschlag wüsste viele Beispiele, wo er im öffentlichen Verkehr vor Grenzen steht. Aber auch in anderen Lebensbereichen. Zum Beispiel beim Einkaufen. Das Konzept des Supermarktes ist bekanntlich auf Selbstbedienung aufgebaut. Doch wer die Etikette auf den Lebensmitteln nicht lesen kann, ist auf Kundenberater angewiesen. Von ihnen gibt es allerdings nicht genug, klagt Schmuckerschlag. Das Internetshopping bietet eine sinnvolle Alternative. Doch auch hier steht er oft an, wenn ihm nicht barrierefrei aufgebaute Webseiten den Zugang zu Inhalten versperren. Er schreckt nicht davor zurück, für seine Rechte einzustehen, erklärt der 29-Jährige. Immerhin ist der Schutz vor Diskriminierung in Österreich seit 2006 im Behindertengleichstellungsgesetz verankert. Fühlt sich Schmuckerschlag wegen seiner Behinderung benachteiligt, schreibt er zuerst dem betroffenen Unternehmen und macht es auf seine Pflichten aufmerksam. Lenkt dieses nicht ein, meldet er den Fall bei einer Schlichtungsstelle des Sozialministeriumservice. Die bittet die zuständigen Personen zum Gespräch und leitet so einen Einigungsversuch ein. Bleibt dieser erfolglos, kann eine Klage eingebracht werden.
Als behinderter Mensch gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – dafür möchte sich Mathias Schmuckerschlag einsetzen und dieses Ziel auch anderen Blinden mit auf den Weg geben. Er findet klare Worte:
Und was gibt er den Sehenden mit? Ihm fällt schwer, gibt er zu, auf sie zuzugehen. Doch auch umgekehrt stößt er auf wenig Interesse eines gegenseitigen Kennenlernens. Das macht das Knüpfen von Kontakten schwierig. Selbst Student der Slawistik an der Universität Wien, würde er es spannend finden, mit seinen Studienkollegen ins Gespräch zu kommen. Ganz könne er sich selbst diese Berührungsangst nicht erklären, denn "dass ein Blinder weder beißt noch ansteckend oder sonst was ist, weiß man doch". Für seine nichtblinden Mitmenschen hat er folgende Botschaft:
Hier knüpft auch Erich Schmid an: Die größten Barrieren befinden sich laut ihm in den Köpfen der Menschen. Nämlich dort, wo nicht alles berücksichtigt und bedacht wird. Oder dort, wo aus Unkenntnis lieber kein Schritt auf den anderen zu gemacht wird. Oder sogar einer zurück.
"Manchmal sind die Leute überrascht, dass wir ganz normale Sachen machen können", fällt den Zwillingen da ein. "So wie auf das Stockbett klettern oder Kartenspielen eben." Und das auch noch ziemlich gut, denke ich mir. Ich zähle die Punkte der Karten zusammen, die sich in meiner Hand zusammengesammelt haben. Wieder ist eine Runde vorbei. Und immer noch liege ich weit zurück. Die nächste Runde muss besser werden, rede ich mir gut zu, und mische die Karten neu.